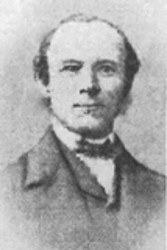Der Bildhauer Johannes Janda1 wurde in Klein Darkowitz (tschech.: Darkovičky), bei Hultschin (tschech.: Hlučin) im damals zum preußischen Kreis Ratibor (poln.: Racibórz) gehörenden Hultschiner Ländchen (tschech.: Hlučínsko) geboren. Obgleich in seinem Elternhaus vermutlich nur der nordmährische Dialekt gesprochen wurde, ist die Bezeichnung „deutscher Bildhauer“ durchaus berechtigt, weil seine künstlerische Entwicklung ausschließlich im deutschen Kulturkreis erfolgte, er preußischer Staatsbürger war und sicherlich auch so empfunden hat. Die deutsche Sprache erlernte er erst im Verlaufe seiner Ausbildung. Das war bei vielen Hultschinern keineswegs ungewöhnlich.2
Sein Vater war ein kleiner Tischlermeister mit künstlerischen Ambitionen, z. B. beim Schnitzen und Anfertigen von Kruzifixen und Grabkreuzen. Reichtümer konnte er mit seinem Handwerk nicht schaffen und so lebte die Familie in sehr einfachen und bescheidenen, dörflichen Verhältnissen. In einer Skizze berichtete Janda selbst, wie sich seine Jugend gestaltete. Oft musste er die Schafe und einzige Kuh der Familie hüten. Dabei beschäftigte er sich ebenfalls mit Schnitzarbeiten, wie er sie beim Vater sah.
Der damalige Bürgermeister von Hultschin wurde auf sein Talent aufmerksam und vermittelte den begabten Tischlersohn an den damaligen Grundbesitzer von Hultschin und Klein Darkowitz, Dr. Wichura. Dieser gab dem Jungen Zeichenunterricht und legte damit erste Grundlagen für eine spätere künstlerische Tätigkeit. Diese Förderung wurde nach dem Verkauf der Herrschaft vom neuen Grundherren, Baron Hubert v. Stücker, Ritter von Weyershof, übernommen. Dieser erkannte Jandas besonderen Talente noch deutlicher. Auf dem Schloss Hultschin leitete er notwendigerweise jetzt eine systematische Bildung des begabten Jungen ein und als die Herrschaft 1845 wieder verkauft wurde, nahm er ihn mit nach Breslau.3 Dort erhielt er Privatunterricht und konnte die damalige Königliche Kunst- und Gewerbeschule besuchen.
Janda ging diesen Weg sicherlich freiwillig und mit persönlicher Überzeugung, denn er war es dann auch, der den späteren Maler, Johannes Bochenek aus Hultschin, ebenfalls ein Tischlersohn, letztlich bewegte, die Berliner Kunstakademie zu besuchen.4
Später wurde durch seinen Förderer sein Umzug nach Dresden und der Besuch der dortigen Kunstakademie ermöglicht. In Folge der Ereignisse der Deutschen Revolution 1848 musste der liberal-demokratisch eingestellte und mit Ferdinand Lassalle befreundete von Stücker in die Schweiz flüchten. Seinen Schützling Janda konnte er jedoch noch nach Berlin, in das Atelier des damals meist gefragten klassizistischen Bildhauers, Christian Daniel Rauch vermitteln. Rauch, schon immer ein Förderer von Talenten, nahm ihn 1849 als Schüler an. Jetzt konnte er seine Begabungen voll entfalten, u. a. arbeitete er an einem Hauptwerk von Rauch, dem bekannten berliner Reiterstandbild von Friedrich dem Großen mit. Im Jahre 1864 eröffnete er dann schließlich ein eigenes Atelier in Berlin. Im Jahre 1855 heiratete er.
Eine Studienreise nach Rom im Rahmen eines Staatsstipendiums war für ihn als glaubensverbundener Katholik und Künstler ein Höhepunkt und Meilenstein. Skizzenbücher von dieser Reise im Jahre 1864 blieben erhalten.
Jandas Schaffen war von Vielseitigkeit geprägt. Wenn er sich auch vorrangig sakraler Kunst widmete, so entstand doch auch eine Reihe von profanen Werken. Obgleich klassizistischer Bildhauer, arbeitete er nicht nur mit dem üblicherweise verwendeten Marmor, sondern beherrschte die verschiedensten Materialien, wie Holz, Elfenbein, Ton, Stein u.a. und schuf zahlreiche Skulpturen, Plastiken und weitere Objekte aller Art und Größe. So findet man lebensgroße bis monumentale figürliche Darstellungen, aber auch kleine Kruzifixe, Porträtbüsten, Reliefs usw. Auch Medaillen und Plaketten entstanden, letztere z. B. von dem Schriftsteller, Schauspieler und Dramaturgen Karl von Holtei und von Papst Pius IX. Eine Büste dieses Papstes, die während der Romreise geschaffen wurde, stand einst im Reichstag, im Fraktionszimmer der Zentrumspartei. Bemerkenswert war auch die Statue aus Stein in Wolfshagen/Uckermark (heute: OT der Gemeinde Uckerland), die seit 1861 an den Grafen Hermann von Schwerin erinnerte und von der heute nur noch Fragmente und der Sockel erhalten sind.
Besonders widmete er sich der Ausstattung der ersten katholischen Kirchen im protestantischen Berlin. Seine Holzskulpturen für den Hochaltar in der 1856 fertiggestellten Kirche St. Michael im historischen Stadtteil Luisenstadt und die Ausstattungen für die Kapelle vom Ursulinenkloster5 sind dafür Beispiele.
Die 1854 geschaffenen Terrakottafiguren der hl. Hedwig und des hl. Karl Borromäus6 für das Hauptportal des katholischen St. Hedwigskrankenhaus in der Spandauer Vorstadt von Berlin zeugen in ihrer Strahlkraft und Aussage von der künstlerischen Reife Jandas. Gleiches gilt für die zwei Meter hohe Figur „Gottesmutter mit Christusknaben“, aus Steinguss, im Innenhof auf einem Ziegelsockel stehend.7
Jandas sakrale Kunst war immer von tief empfundener Religiosität geprägt. Die Spiritualität der handwerklich hervorragend ausgeführten Heiligenfiguren ist deutlich. Sie vermitteln Menschlichkeit und Glauben, ohne dass sie selbst als reale Menschen wahrgenommen werden, und bauen so für die Betrachter eine Brücke zum Transzendenten.
Janda schöpfte aber nicht nur aus dem christlichen Glauben. Seiner schlesischen Heimat fühlte er sich lebenslang zugetan und viele seiner Werke haben Bezug zu Schlesien oder fanden dort einen Standort. Für seinen Geburtsort stiftete er 1863 eine Mariensäule, an deren Einweihung damals etwa 5000 Personen teilnahmen. Diese Säule steht heute noch in dem jetzt tschechischen Ort. Eine weitere Säule aus gebranntem Ton schuf er im Auftrag des Grafen Schaffgotsch, die später beim Dorf Schomberg (später poln.: Szombierki), heute ein Stadtteil von Beuthen (poln.: Bytom), aufgestellt wurde.
Eines der Hauptwerke Jandas war die kolossale Hubertusgruppe, in bronziertem Zinkguss ausgeführt, für das Jagdschloss Promnitz des Fürsten von Pleß.8
Im Jahre 1867 wurde ein in gleicher Weise gefertigtes, liegendes Hirschpaar, am Schloss Pleß aufgestellt (evtl. Abgüsse von den Modellen, nach denen zeitgleich für Schloss Glienicke bei Potsdam ein solches Paar gefertigt wurde). Weiter sind im jetzigen Schlossmuseum die Porträtbüste der Anna Caroline von Reuss (geb. Hochberg) und eine Gipsplastik „Fürst Hans Heinrich XI. von Hochberg als Jäger“ zu finden.9
Aus Zinkguss war eine Genovevagruppe,10die sich einst im Park von Rauden (poln.: Rudy (Kuźina Raciborska)) in Oberschlesien befand. Hier gibt es heute nur noch eine kleine Kapelle mit einer von Janda geschaffenen Mutter-Gottes-Figur.

Zu seinen letzten Werken gehören u.a. ein Relief „Maria, dem hl. Dominikus den Rosenkranz reichend“ in der Pauluskirche in Berlin-Moabit, sowie eine Kindergruppe für die einstige Berliner Königsbrücke.
Nicht alles aus Jandas umfangreichem Schaffen kann hier erwähnt werden und viele seiner Werke sind heute verloren. Die politischen Veränderungen und historischen Ereignisse im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen sind dafür verantwortlich. Das betrifft sogar sein Grab auf dem Domfriedhof St. Hedwig in der Liesenstraße. Dieser Friedhof befand sich später im Mauerstreifen des geteilten Nachkriegs-Berlin.12
Einzelnachweise und Fußnoten:
1) Sein Taufname lautet Johann Balthasar Janda, siehe Oberschlesische Persönlichkeiten. Führer durch die Ausstellung Arbeit und Kultur in Oberschlesien, Breslau vom 01. – 31. Oktober 1919, Hrg.: Arbeitsausschuss, 2. verbesserte Auflage, Selbstverlag der Ausstellung, Breslau, 1919, S.57-76, hier S.65. Der Name steht auch im polnischen Wikipediaeintrag (abgerufen am 26.02.2014). Einige Quellen verwenden auch den mährischen Vornamen Jan, der sicherlich als Kind sein Rufname war.
2) Das Hultschiner Ländchen ist ein Teil Oberschlesiens und gehört gem. Versailler Vertrag von 1919, seit 1920 zu Tschechisch-Schlesien. Die Einwohner nannten sich im heimatlichen Dialekt „Prajzové“/ Preußen – sonst heißen Preußen auf tschechisch „Prusy“.
3) Der Erwerb und Verkauf der Herrschaft Hultschin durch den Baron von Stücker fand zweimal statt. Einmal 1832/1836 und nochmals 1844/1845. Der angesprochene Vorgang bezieht sich auf den zweiten Kauf/Verkauf.
4) siehe auch Wikipediaeintrag: Johannes Bochenek (abgerufen am 26.02.2014).
5) Das Ursulinenkloster unterhielt ein von Ursulinen geleitetes Mädchenpensionat, Schule und Waisenhaus im Berliner Stadtteil Kreuzberg, in der Lindenstraße.
6) Der hl. Karl Borromäus (1538-1584) (abgerufen am 26.02.2014), war Kardinal und Vertreter der Gegenreformation. Man rief ihn besonders auch bei Pestepidemien an.
7) Webseite: Kauperts Straßenführer durch Berlin. Luisenstädtischer Bildungsverein, Berliner Bezirkslexikon, Mitte, Große Hamburger Str., (abgerufen am 05.03.2014).
8) siehe Wikipdiaeintrag: Jagdschloss Promnitz, „Der Fürst als Jäger mit Hirschen“, (lt. dieser Quelle: 1864; jedoch lt. 1. Quelle unter 2: 1868) (abgerufen am 11.03.2014).
9) poln. Webseite: Muzeum Zamkowe w Pszczynie (abgerufen am 08.03.2014).
10) Der Legende nach lebten Genoveva von Brabant (abgerufen am 26.02.2014) und ihr Sohn etwa um das Jahr 730 herum, sechs Jahre in einer Höhle, wo sie von der Gottesmutter mittels einer Hirschkuh mit Nahrung versorgt wurden. Sie wird bis heute als Heilige verehrt.
11) siehe Wikipediaeintrag: Ernst von Pardubitz (abgerufen am 26.02.1914).
12) siehe Wikipediaeintrag: Liesenstraße in Berlin (abgerufen am 26.02.1914).
Abbildungen:
– Selbstbildnis des jungen Janda, entnommen aus Oberschlesien im Bild, Jg. 1928, Nr. 31, S.2. Ein Foto von 1870 findet man im entsprechenden Wikipedia-Artikel (abgerufen am 26.02.2014.)
– Ernst von Pardubitz: Grabskulptur aus weißem Marmor in der Stadtpfarrkirche zu Glatz/ Kłodzko, nach Wikpedia (s.o.)
weitere Quellen:
– Korrespondenznachrichten. Morgenblatt für gebildete Leser, Jg.41, 8. Juli 1847:162, S.647-648, Schlesien (Schluss), Kunstausstellung, S.648, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart und Tübingen,1847;
– Ferdinand Lassalle: Nachgelassene Briefe und Schriften,1. Band. Briefe von und an Lassalle bis 1848, Hrsg. Gustav Meyer, Einführung in den ersten Band, Kapitel VII, S. 33-36, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, Berlin; Verlagsbuchhandlung Springer Berlin, 1921;
– Vermischtes. Meyer‘ Monatshefte, Deutsch-amerikanische Zeitschrift für Literatur, Kunst und Gesellschaft,1.Jg., Bd.2, Juli 1853:2, S.153-154, Aufzählung zu: Berliner Kunstakademie, S.154, New York, 1853;
– Simon Macha: „Zwei Künstler aus dem Hultschiner Ländchen“. Der Oberschlesier, Wochenschrift für Politik, Kultur und Wirtschaft, 1921:35, III. Jg., S.612-613, Oppeln 1921;
– Johann Janda ein Bildhauer unserer Heimat. Oberschlesien im Bild, 1928:31, S.2-3, Gleiwitz 1928;
– Wikipediaeintrag: Johannes Janda (abgerufen am 26.02.2014); Deutscher Text von der polnischen Webseite der Abtei Groß Rauden: Pcysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach – Galeria/ unter Denkmäler/Mutter-Gotteskapelle (abgerufen am 11.03.2014).
Helmut Steinhoff