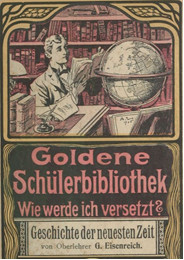Sein voller Name lautet Gustav Ignatz Eisenreich. Der Vater, Friedrich Eisenreich war Steueraufseher und verstarb später in Zduny. (1943–1945 Treustädt; poln.: Zduny,).
Er ermöglichte dem Sohn den Besuch des Gymnasiums in Inowraslaw (1904 bis 1920 und 1939 bis 1945: Hohensalza; poln.: Inowrocław). Nach bestandener Reifeprüfung 1890 schloss ein Lehrerstudium an der Universität Breslau bis 1895 an. Die Lehramtsprüfung wurde 1896 für das Fach „Geschichte in oberen Klassen“ abgelegt. Weitere Prüfungen berechtigten zum Unterricht in mittleren Klassen für die Fächer Erdkunde, Religion, Latein und Deutsch. Die spätere Erweiterungsprüfung 1905 für den „Geografieunterricht in oberen Klassen“ entsprach seinen fachlichen Interessen.
Nach ersten Berufserfahrungen von 1898 bis 1899 am Pädagogium in Niesky, der Internatsschule der Herrnhuter Brüdergemeine und am Progymnasium Striegau, folgte 1900 eine Festanstellung an der Oberrealschule in Kattowitz als Oberlehrer (später: Studienrat). Eine von ihm dort angelegte, umfangreiche, naturwissenschaftliche Sammlungen diente einer anschaulichen und interessanten Unterrichtsgestaltung. Beachtung fanden seine Publikationen und Beiträge zu Lehrstoffinhalten und deren Vermittlung.
Kattowitz lag vor dem Ersten Weltkrieg unmittelbar an der Grenze zum zaristischen Russland. Trotzdem war die Initiative von Eisenreich zur Einführung eines fakultativen Russischunterrichts damals sehr ungewöhnlich. Sein bürgerlich-gesellschaftliches Engagement ging weit über die Tätigkeit als Pädagoge hinaus, wie u.a. die Mitarbeit als Schriftführer der Kolonialgesellschaft Kattowitz, bzw. die Teilnahmen am Deutschen Geografentag 1907 in Nürnberg oder 1913 in Straßburg (i. E.) belegen.
Wie Kattowitzern Adressbüchern zu entnehmen ist, führte er ab 1912/13 den Ehrentitel „Professor“ im Namen, der in Preußen bis 1918 auch an verdiente Oberlehrer vergeben werden konnte.
Zu seinen Schülern gehörte der spätere Schriftsteller Arnold Zweig, der bei ihm Deutschunterricht erhielt. Zweig erinnerte sich an ihn als eine Person, die gem. eigenen Aufzeichnungen, seine Phantasie „in Zucht und Ordnung gezwungen hat“.
Nach dem 1. Weltkrieg und den Volksabstimmungen in Oberschlesien fiel Kattowitz mit dem östlichen Landesteil der Provinz 1922 an die Zweite Polnische Republik. Als deutscher Lehrer und Staatsbeamter wechselte er 1923 in den bei Deutschland verbliebenen Landesteil. In diesem Zusammenhang übergab er der polnischen Naturschutzstelle in Poznań ein Verzeichnis aller Naturdenkmäler im Abtretungsgebiet.
Über 26 Monate erhielt er dann Zuwendungen aus der staatlichen Beamtenfürsorge, bis er schließlich in Oppeln übergangsweise wieder unterrichten konnte. Erst die Einstellung an der Oberrealschule Gleiwitz ab Oktober 1926 beendete diese Zeit persönlicher Unsicherheiten.
Allerdings fand Eisenreich in diesen Monaten mehr Möglichkeiten, sich den weiteren Aufgaben und Interessen zu widmen. Als Gründer und Geschäftsführer der geologischen Vereinigung Oberschlesiens im Jahre 1924 und als Vertrauensmann für naturkundliche Bodenaltertümer, sah er als besondere Aufgabe an, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Region zur Geologie und Paläontologie zu verbreiten und sie allen Schichten der Bevölkerung zu erschließen. Von Bedeutung für den sich entwickelnden Naturschutz war die nebenamtliche Tätigkeit als Kommissar für Naturdenkmalpflege der Provinz Oberschlesien, hervorgegangen aus der Tätigkeit als 1. Geschäftsführer eines entsprechenden Landschaftskomitees. Daraus ergab sich dann noch die Leitung der Abteilung Naturschutz beim Bund für Heimatschutz. Er gehörte auch zum Vorstand des Oberschlesischen Tierschutzverbandes.
Eisenreich unterhielt intensive Kontakte zu namhaften Naturwissenschaftlern oder Persönlichkeiten aus der Region. Beispiele sind die Geowissenschaftler Martin Schwarzbach und Paul Assmann, der Botaniker Theodor Schube, der Katscher Heimatforscher Richard Keilholz und der Prähistoriker Bolko von Richthofen. Martin Schlott, der Direktor vom Breslauer Zoo (1934 bis 1946), später dann auch Direktor des Wuppertaler Zoos (1947-1950), gehörte ebenfalls zu dem Kreis. Im Jahre 1928 organisierte und leitete er die „Erste Oberschlesische Naturschutzausstellung“ in Ratibor.
Ab Oktober 1929 wurde er vom Schuldienst freigestellt und arbeitete als hauptamtlicher Provinzialkommissar für Naturdenkmalpflege in einer Gleiwitzer Geschäftsstelle. Diese Aufgabe verflocht er eng mit der Arbeit der Geologischen Vereinigung und den weiteren Aufgaben. Das gewünschte Verständnis für einen allgemeinen Naturschutz wurde durch Exkursionen und Ausflüge gefördert, zu denen immer Interessierte aus allen Schichten der Bevölkerung, lokale Persönlichkeiten und Wissenschaftler aus anderen Fachgebieten eingeladen wurden. So konnten dann letztlich auch Schutzmaßnahmen durchgesetzt werden, wie sie damals noch keineswegs selbstverständlich waren. Erste Naturschutzgebiete wurden eingerichtet. Weitere Beispiele sind u.a. die Schutzstellung von Schnee- und Maiglöckchen in einigen Kreisen. Willkürliche Baumfällungen wurden öffentlich angeprangert. Auch die im Industrie- und Bergbaurevier bereits massiv bestehenden Probleme der Umweltverschmutzung wurden kritisch betrachtet und eine Erhaltung und Bewahrung von Landschaft und Natur angemahnt.
Die von Eisenreich herausgegebenen Jahresberichte der Geologischen Vereinigung Oberschlesiens zwischen 1924 und 1941 sowie die Berichte zur umfangreichen Naturschutzarbeit fanden viel Beachtung. Sie entwickelten sich zu anerkannten, umfassenden und beliebten populärwissenschaftlichen Publikationen und wurden später sogar den Schulen zur Anschaffung empfohlen.
Eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Publizisten, Schriftsteller und Herausgeber der Monatszeitschrift „Der Oberschlesier“, Karl Schodrock (bis 1939: Karl Sczodrok) führte dazu, dass Eisenreich zwei Sonderhefte dieser damals weit verbreiteten Regionalzeit-schrift mit herausgab.
Bemerkenswert ist, dass Eisenreich sich den politischen Umbrüchen seiner Zeit nie so angepasst hat, wie das viele andere taten. Zum Beispiel gab er noch 1939 als Herausgeber des Jahresberichtes der Geologischen Vereinigung einem gedruckten Beitrag Raum, der Bezug auf eine polnischsprachige Informationsquelle herstellte.
Seine Aufgaben als Leiter der Geologischen Vereinigung führte er nach dem Erreichen des Pensionsalters im April 1932 intensiv weiter, bis 1941. Kurz vor dem 75. Geburtstag schied er dann endgültig aus.
Indizien berechtigen zur Annahme, dass die letzte Veröffentlichung (s. unter Werke) im Jahre 1944 über das Steinkohlengebirge bei Nikolai eine Promotionsschrift war.
Eisenreich war evangelisch, verheiratet (mit Johanna Eisenreich, geb. Hoffmann) und Vater von 5 Kindern. Als im Januar 1945 die Kriegsereignisse Gleiwitz erreichten, verstarb er auf der Flucht beim Luftangriff auf Dresden. Die Umstände des Todes von diesem verdienstvollen, vielseitigen oberschlesischen Lehrer, Geologen, Heimatforscher und Naturschützer sind unbekannt.
Werke (in Auswahl): Die von Eisenreich in den Jahren 1924 bis 1941 herausgegeben Jahresberichte der Geologischen Vereinigung Oberschlesiens erschienen stets auch mit Beiträgen aus seiner Hand. – Über den Geschichtsunterricht in der Quarta an lateinlosen Anstalten, Kattowitz 1902. – Geschichte der neueren Zeit von 1517 bis 1789, Leipzig 1906. – Geschichte der neuesten Zeit von 1789 bis zur Gegenwart, Leipzig 1906. – Die Oberschlesische Landschaft und ihre Naturdenkmäler, in: Der Oberschlesier 1920:2(49), S. 1-3. – Naturschutz in Oberschlesien. Oberschlesien: Ein Land deutscher Kultur, S. 63-67, Gleiwitz 1921. – Karl Sczodrok. Natur und Landschaft in Oberschlesien, Oppeln 1927. – Der Neuhammer Teich, in: Der Oberschlesier 1927:9(6), S. 351-354. – Dem Gedenken dreier heimgegangener Naturforscher und Naturfreunde Oberschlesiens., in: Der Oberschlesier, 1927:9(6), S. 378-379. – Der Lenczok bei Ratibor, in: Der Oberschlesier, 1927:9(6), S. 323-326. – Naturkundliche Arbeit in Oberschlesien, Oppeln 1928. – Die Freilandanlage von Bobrek., in: Der Oberschlesier, 1929:11(8), S. 565-566. – Naturkundliche Bausteine aus Oberschlesien, Oppeln 1929. – Naturdenkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege in Oberschlesien: Lagebericht, Oppeln 1929. – Landschaft und Naturdenkmäler im Kreise Tost-Gleiwitz, Gleiwitz 1930. – Lehrgang in Naturdenkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege vom 14. November bis 18. November 1929 in Gleiwitz, in: Der Oberschlesier 1930:12(6), S. 471-474. – Emanuel Czmok, (Nachruf), in: Der Oberschlesier 1934:16(7), S. 418-419. – Spuren der Eiszeit und Nacheiszeit in der oberschlesischen Landschaft und im Falkenberger Lande. Heimatkalender des Kreises Falkenberg 1937, S. 92-96. – Das Steinkohlengebirge in der Umgebung von Nikolai. Technische Hochschule Breslau, (s.n.) 1944.
Weblinks: BBF – Archivdatenbank: Personaldaten von Lehrer und Lehrerinnen Preußens. Personalbogen Eisenreich, Gustav . – M. Syniawa, Mały słownik przyrodników Śląskich. Gustav Eisenreich. – Kleines Wörterbuch der Naturforscher Schlesiens (in poln.). – M. Syniawa, Zarys historii badań przyrody Górnego Śląska do roku 1945 – Skizze der Geschichte der Naturforschung Oberschlesiens bis 1945. (in poln.). – Arnold Zweig, Früchtekorb jüngste Ernte; Aufsätze., Rudolfstadt, 1956. – Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Eisenreich.
Helmut Steinhoff